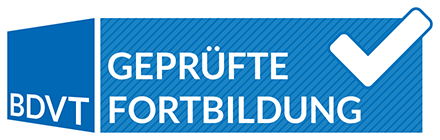Was ist Agilität – oder: weg vom Sprinter hin zum Crossläufer!
Agiles Führen, agiles Management, agiles Mindset, Agilität in Praktiken und Methoden… was ist Agilität eigentlich genau? Was bedeutet agil sein in der Unternehmenswelt in Zeiten von Krisen? In diesem Artikel erklären wir euch, was es mit der Agilität in Teams und Unternehmen auf sich hat – unter „normalen“ und anderen Umständen!
Was bedeutet Agilität?
Wenn wir im Duden den Begriff Agilität Bedeutung nachschlagen, steht dort: „Von großer Beweglichkeit zeugend; regsam und wendig“. Viel Organisationen machen aus Agilität Schnelligkeit. Doch das führt teilweise zu fatalen Folgen, die wir bei einigen „Zwangstransformationen“ in Richtung Agilität vorfinden. Der Unterschied zwischen Schnelligkeit und Wendigkeit lässt sich sehr gut mit folgendem Bild verdeutlichen:
- Der bewegliche und wendige Läufer – der Crossläufer – ist nicht unbedingt derjenige, der am schnellsten im Ziel ist, sondern derjenige, der sich wendig in seiner Bewegung an die Umgebung anpasst und seinen Kurs stetig korrigieren kann. Dieses Bild kann eine treffende Metapher für Agilität darstellen.
- Der klassische Sprinter ist nur auf seiner eingeübten, geradlinigen und vorhersehbaren Tartanbahn schnell. Mit der gleichen Art zu laufen wäre er querfeldein auf einem Gelände voller wechselnder Untergründe und Hindernissen voraussichtlich nicht besonders erfolgreich. Um dort voranzukommen, müsste er seine Art des Laufens extrem verändern und an den jeweiligen Untergrund anpassen. Insofern ist der Sprinter kein gutes Bild für Agilität ihrer eigentlichen Bedeutung.
Mit wendiger Beweglichkeit unterwegs zu sein, ist also eine schöne Definition für Agilität und das Bild des . Genau das brauchen Unternehmen und Teams, um auf dem unsicheren Gelände der Gegenwart und Zukunft voranzukommen und in ihrer Anpassungsfähigkeit. Gerade zurzeit wird uns allen die Bedeutung von irritierenden Veränderungen besonders vor Augen geführt. Vorbei ist es mit dem Konzept der Planungen für die nächsten Monate, maximal für einen Zeitraum von zwei Wochen sind Entscheidungen tragfähig und konsistent.

Agilität in Unternehmen lehrt uns im Nebel auf Sicht zu fahren
Das oben beschriebene Szenario für iterative Veränderungen erleben wir seit den Multi Krisen der letzten Jahre tagtäglich. Doch wie bleiben Unternehmen dabei auf Kurs? Wie schaffen Sie trotzdem einen sicheren Rahmen und vermitteln ihren Mitarbeiter und Kunden Vertrauen und Verlässlichkeit?
Agilität als Grundgedanke hilft uns genau in diesen komplexen und unsicheren Zeiten auf Kurs zu bleiben, indem wir sozusagen im Nebel auf Sicht fahren lernen. Statt das Auto an den Rand zu fahren oder im Nebel einfach draufloszufahren ohne zu wissen ob wir noch auf dem richtigen Kurs sind, bewegen wir uns mit Hilfe der agilen Frameworks strukturiert und flexibel immer weiter voran und prüfen stetig ob wir noch auf dem richtigen Weg sind. Agile Arbeit bedeutet in kurzen Zyklen auf Sicht zu fahren und dabei konsequent einen Umsetzungsfokus zu verfolgen, um dann die Ergebnisse zu überprüfen und anzupassen. Dabei helfen Methoden die der Priorisierung und Fokussierung auf die Wertschöpfung dienen.
Agiles Führen
Führung im klassischen Verständnis meint vor allem eines: Orientierung geben und in kritischen Situationen wirksam Einfluss nehmen. Also Richtung klären, Entscheidungen ermöglichen und Verantwortung tragen.
In agilen Kontexten kommt eine weitere Dimension hinzu: Führung über Rahmenwerke. Gemeint sind bewusst gesetzte Strukturen, Regeln und Vereinbarungen, die Zusammenarbeit ermöglichen – idealerweise solche, die Teams sich selbst geben. Nicht als Korsett, sondern als Starthilfe für Selbstorganisation.
Agiles Führen bedeutet daher nicht, stärker zu steuern, sondern Fähigkeit zur Selbststeuerung aufzubauen. Führung wird unterstützend, klärend und entwicklungsorientiert. Ein agiles Framework wie Scrum kann dabei helfen, weil es Orientierung gibt, was gebraucht wird, ohne vorzuschreiben, wie gearbeitet werden muss. Genau darin liegt seine Stärke und auch seine Grenze.
Rollen wie Scrum Master oder Product Owner übernehmen in diesem Kontext temporär Führungsaufgaben: Sie moderieren, coachen, schaffen Fokus oder denken strategisch. Nicht aus hierarchischer Macht heraus, sondern aus ihrer Rolle im System.
Entscheidend ist: Agile Führung ist nicht an Positionen gebunden, sondern an Rollen und Situationen. Und sie setzt voraus, dass Menschen die Fähigkeit inne haben sich selbst führen zu können oder dabei unterstützt werden, es zu lernen.
Deshalb ist agiles Führen kein einheitlicher Führungsstil und kein Best-Practice-Modell. Es ist vielmehr ein Zusammenspiel aus Haltung, Rahmen und Rollen, das Teams dabei unterstützt, Verantwortung zu übernehmen. Der zentrale Wert dabei ist nicht Kontrolle, sondern Hilfe zur Selbsthilfe.

Agile Werte
In vielen Unternehmen wird Agilität mit einer bestimmter Methodik oder Prozessen gleichgesetzt. Doch im Kern beschreibt Agilität eine Haltung und damit eine Form der Zusammenarbeit, die auf Anpassungsfähigkeit, Beweglichkeit und Vertrauen beruht. Agile Werte sind dabei keine dekorativen Worte, sondern geben Orientierung: Sie zeigen, wie Organisationen Veränderung gestalten und auf Komplexität reagieren. So wird Agilität im Unternehmen und gestaltet ein lebendiges Arbeitsumfeld.
Wer agile Transformation ernst meint, beginnt nicht bei den Methoden, sondern bei der Kultur. Denn Werte sind psychologisch betrachtet Handlungsimpulse. Sie sind der innere Kompass, an dem sich Entscheidungen und Verhalten ausrichten – besonders in dynamischen Zeiten. Agilität bedeutet, Verantwortung zu teilen, Orientierung zu geben und das Miteinander in Teams bewusst zu gestalten.
Schon Abraham Maslow hat mit seiner Bedürfnispyramide deutlich gemacht: Nach unseren Grundbedürfnissen suchen wir vor allem eines: Sicherheit. In der heutigen Unternehmenswelt entsteht diese Sicherheit nicht mehr nur durch Strukturen, sondern durch gelebte Werte. Werte, die nicht nur formuliert, sondern auch eingehalten werden. Wird in einem Unternehmen Pünktlichkeit als Wert verstanden, wirkt sich ein Verstoß unmittelbar auf die Zusammenarbeit aus. Doch was, wenn Eigenverantwortung und flexible Rahmenbedingungen höher gewichtet werden? Dann wird das Zuspätkommen mit entsprechend nachvollziehbarer Begründung in einem anderen Licht gesehen: als Teil einer selbstbestimmten Arbeitsweise, in der Teams ihre Abläufe selbst gestalten. Genau hier zeigt sich: Agilität ist keine Definition auf dem Papier, sondern eine gelebte Realität. Die Herausforderung vieler Unternehmen liegt nicht in der Einführung agiler Methoden wie Scrum, sondern in der konsequenten Umsetzung agiler Prinzipien. Wenn Werte nur deklariert, aber nicht gelebt werden, entsteht kein Vertrauen. Ohne Vertrauen zerfällt jede Struktur egal, wie modern das Management aufgestellt ist.
Vertrauen ist wie das rote Schirmchen einer Reiseleitung. Die Gruppe folgt nicht, weil sie muss sondern weil sie will. Weil das Schirmchen Orientierung gibt. Agilität funktioniert genau so: Sie lebt davon, dass Menschen gemeinsam in Bewegung kommen. Dass sie sich auf gemeinsame Werte verständigen und dass die Organisation den Rahmen schafft, in dem diese Werte auch wirken dürfen.
Agilität ist damit mehr als nur ein Trend oder ein neues Vorgehensmodell. Sie ist Ausdruck einer Haltung, mit der Unternehmen auf Veränderungen reagieren, neue Lösungen entwickeln und ihre Teams stärken. Wer diesen Weg geht, entdeckt nicht nur die Dimensionen agiler Zusammenarbeit sondern auch die Kraft, die entsteht, wenn Werte wirklich tragen.
Diese agilen Werte gibt es:
- Selbstverpflichtung (Committment)
- Fokus (Focus)
- Mut (Courage)
- Respekt (Respect)
- Offenheit (Openness)
Agile Prinzipien
Aus den agilen Werten der agilen Softwareentwicklung leiten sich Prinzipien der Agilität in Unternehmen ab. Auch Prinzipien bieten einen Rahmen für Organisationen, der aber viel kleiner ist, nichtsdestotrotz Orientierung für die Zusammenarbeit bietet. Durch sie kann das Management von Organisationen den Spielraum gestalten, den Mitarbeiter nutzen dürfen. Dies können sowohl Entscheidungs- wie auch Handlungsprinzipien sein, wobei es Überschneidungen zwischen diesen Kategorien geben kann. Nach welchen Kriterien entscheide ich unter welchen Rahmenbedingungen? Wonach handle ich in der Praxis? Nehmen wir das Prinzip „wir realisieren Ideen, die vom Vertrieb kommen sofort und ohne diese zu bewerten“, so steckt darin ein Entscheidungsprinzip und ein Handlungsaspekt in der Zusammenarbeit.
Prinzipien stärken die Selbstverantwortung und den Umgang mit Komplexität in Organisationen. Sie fördern Entwicklung und klären Anforderungen und richten sich an den selbstdenkenden Menschen. Der erhält dadurch einen Filter, durch den er all die tausenden kleinen Entscheidungen des Alltags im Sinne der Anpassungsfähigkeit und Flexibilität vorsortieren kann. Die 12 agilen Prinzipien sind auch Entwicklungsinstrumente, sie schulen Denken in Veränderungen und erhöhen Flexibilität, wenn es in organisationales Lernen im sinne der Anpassungsfähigkeit eingebettet ist.
Prinzipien sind als Konzept sozusagen Strukturelemente für den Geist. Sie schulen das Denken ähnlich wie die Dialektik als Lehre von den Gegensätzen. Eingebettet in Reflexion sind sie deshalb geeignet, Denken in kleinen Schritten zu weiten, die Sicht auf anderes zu lenken und damit auch die Anpassungsfähigkeit zu steigern und gleichzeitig die Anforderungen klar im Blick zu halten.
Diese konkreten, handlungsorientierten Ableitungen können auch definiert werden als Regeln, die eine Entscheidungsgrundlage fürs Management und die Teams bilden. Prinzipien helfen auch bei der Rahmengestaltung des Managements in Komplexität, denn sie leiten zu einer Handlung an.
Beispiele für agile Prinzipien:
- Iteration
- Flow
- Selbstorganisation
- Kontinuierliche Verbesserung
- Reflexion
- Adaption
- Sinn stiften
- Vielfalt
- Verantwortung
Agile Praktiken
Zum guten Schluss müssen die agile Werte und Prinzipien in Form von agilen Praktiken bzw. Methoden in Organisationen umgesetzt werden. Werden verschiedenen solcher Praktiken miteinander verknüpft, spricht man von einer agilen Methode oder einem Framework (z. B. Scrum). Diese kommen aus der Softwareentwicklung und müssen in anderen Bereichen entsprechend anschlussfähig an die Rahmenbedingungen angepasst werden. Methoden sind auch Strukturelemente, die das Verhalten lenken. Wie in der Moderation bieten solche Methoden die geeigneten Strukturen um Menschen in ihrem Verhalten zielgerichtet zu unterstützen. Beispiele für agile Praktiken und Methoden:
- Rollen
- Review
- Plannings
- Daily Scrum
- Customer Journey
- User Stories
- Persona
- Timeboxing
Die 5 Kernelemente der Agilität
Es gibt unzählige Definitionen und Interpretationen über den Begriff Agilität. Bei vielen Organisationen ist der Begriff verbrannt, weil die Erlebnisse und Ergebnisse aus unterschiedlichen Gründen nicht nur ernüchternd, sondern frustrierend waren.
Oftmals wurde Agilität dabei nicht verstanden, sondern als Synonym für Veränderungsdruck und das daraus entstandene Chaos benutzt. Fast immer fehlt die Basisarbeit an der Kultur und an der Struktur.
Wir arbeiten gerne an den Strukturen/Prozessen und verändern damit den Kontext und ernten als Ergebnis des Prozesses idealerweise eine veränderte Kultur. Andere Coaches vertreten den Standpunkt erst an der Kultur und dem Mindset zu arbeiten als Basis der Veränderung. Das ist eine Henne – Ei Thematik und damit eine philosophische Frage. Im besten Falle arbeiten wir sowohl an der Struktur wie an Kultur und begünstigen erwünschtes Verhalten und Fähigkeiten und wirken damit auf das Mindset der Personen ein.

Agile Arbeitsweisen sind an 5 Kernelemente geknüpft:
1. Kundenzentrierung, um die Bedürfnisse und Marktanforderungen von heute und morgen zu erspüren

Das Herzstück jeder Agilität ist der Kunde, der im wahrsten Sinne ins Zentrum unserer Überlegungen und Handlungen gestellt wird Er ist unser heutiger und zukünftiger Arbeitgeber und entscheidet über die Existenz jeder Organisation. Seine jetzigen Bedürfnisse zu verstehen und zu erfüllen und seine zukünftigen Bedürfnisse zu erspüren und zu explorieren ist der Sinn und Zweck all unserer Handlungen. Konkret bedeutet das zum einen im operativen Geschäft mit Stakeholder Maps, Personas, Empathy Maps und Customer Journeys zu arbeiten und sich kontinuierlich Feedback von Kunden einzufordern und dieses umzusetzen. Zum anderen werden Trends beobachtet und zukünftige Kundenbedürfnisse exploriert.
2. Selbstorganisierte Teams, die crossfunktional gemeinsame Ziele verfolgen und selbst entscheiden und planen können

Um die komplexen Anforderungen und Herausforderungen des Umfelds zu erfüllen brauchen Unternehmen crossfunktionale Teams, die die Kompetenzen und die Dynamik innehaben, um in Sinne der Wertschöpfung für den Kunden sich selbst zu organisieren und schnelle Entscheidungen zu treffen. Das heißt aber noch lange nicht, dass damit eine totale Autonomie sinnvoll wäre oder gar immer nützlich. Selbstorganisation im sinne der Agilität bedeutet, dass ein Team sich zu einem gewissen Grad selbst verwaltet und/oder gemeinsame Entscheidungen treffen kann – welche das sind, obliegt dem „Rahmengeber“. Deshalb kann dieser Begriff sehr weit und sehr breit ausgelegt werden.
Wir unterscheiden 4 Stufen der Entwicklung Richtung Selbstorgisation:
- Selbstorganisation bezogen auf fachliche und inhaltliche Aufgaben (Stufe 1),
- Selbstorganisation die neben Stufe 1 auch die Zielsetzung beinhaltet (Stufe 2),
- Selbstorganisation, die neben 1 und 2 auch beinhaltet, dass man selbst wirtschaftet und die Finanzen plant (Stufe 3) und die höchste Stufe bedeutet neben allen vorherigen auch das Einstellen und Kündigen von Personal.
3. Iterative Arbeitsweise, um im komplexen Umfeld zu agieren und schnell zu lernen

Um uns im komplexen Umfeld zurecht zu finden, brauchen wir andere Herangehensweisen als in einfachen oder komplizieren Umgebungen.
Es ist ähnlich dem Fahren auf Sicht im dichten Nebel: wir tasten uns Stück für Stück voran, immer bereit den Kurs zu ändern, sobald wir das nächste Stück des Weges erblicken können. Dazu nutzen wir in der Agilität kurze Sprints die wir kurzzyklisch anpassen können. Anhand der 5 Phasen des ThinkNew-Plan-Do-Check (TPDCA) Zyklus erläutern wie die Phasen solcher Iterationen.
4. Agiles Mindset:

Unter einem agilen Mindset verstehen wir eine flexible und auf Entwicklung und Wachstum ausgerichtete Denk- und Handlungslogik. Diese Haltung hilft Individuen und Organisationen wendig und anpassungsfähig auf das Umfeld zu reagieren und Herausforderungen anzugehen und ist auf lebenslanges Lernen und persönliche bzw. organisationale Weiterentwicklung ausgerichtet. Der Neurobiologe Gerald Hüther sieht eine natürliche Begeisterung der Menschen am Entdecken und Gestalten. Dieser kostbare Rohstoff verschwindet allerdings augenblicklich bei Druck, Misstrauen und Entmutigung. Die gute Nachricht ist: Entdeckerlust und Gestaltungsfreude sind nachwachsende Rohstoffe, und das ein Leben lang. Die Hirnforschung hat in den letzten Jahren viele neue Erkenntnisse geboten, wie Menschen lernen und sich ein Leben lang entwickeln. Eine der vielen spannenden Erkenntnisse lautet: ein Mensch erwirbt nur neues Wissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten, wenn es ihn emotional berührt. Wenn die emotionalen Zentren in seinem Gehirn aktiviert werden, bilden sich an den weitverzweigten Fortsätzen des Mittelhirns neuroplastische Botenstoffe. Diese wirken wie Dünger und stimulieren das Auswachsen weiterer Fortsätze und Vernetzungen. Wir können also nur Neues als Verschaltungsmuster im Gehirn verankern und uns entwicklen, wenn wir uns darüber freuen oder begeistern. Das was es zu lernen gibt, muss wirklich bedeutsam für uns sein. Dazu kann man Mitarbeiter nicht zwingen, man kann sie nur einladen, ermutigen und inspirieren.
Das agile Mindset ist die innere Grundhaltung oder auch die Wurzel, um im Sinne der Agilität die agilen Werte und Prinzipien zu verkörpern.
5. Agile Werte und Prinzipien

Wie oben schon beschrieben sind die agilen Werte und Prinzipien wie ein innerer Kompass: Individuen und Interaktionen zählen mehr als Prozesse und Tools, Zusammenarbeit mit dem Kunden mehr als Vertragsverhandlung. Die Prinzipien der Agilität weben daraus ein feines Netz – iteratives Lernen, mutiges Feedback, kontinuierliche Verbesserung/ Entwicklung und ein tiefes Vertrauen in Selbstorganisation. Gemeinsam formen sie einen lebendigen Rhythmus, in dem Wandel willkommen ist und der Mensch im Mittelpunkt steht.
Was sind die Voraussetzungen damit Agilität wirksam werden kann?
Wer Agilität wirklich voranbringen will, sollte sorgfältig prüfen, welche agilen Veränderungen genau zu welchen Organisationen, Teams und Tätigkeiten passen. Denn so wie Aspirin nicht gegen einen zu hohen Blutzuckerspiegel hilft, so bringt auch Scrum nichts bei Routineaufgaben. Mit einer solchen Vorprüfung wäre schon viel gewonnen. Um Agilität wirksam werden zu lassen braucht es gut ausgebildete agile Coaches, die den Kulturwandel vorantreiben und die Teams und Führungskräfte in der Entwicklung begleiten. Und wenn dann auch noch Ehrlichkeit dazukommt, falls doch einmal das falsche Rezept oder die falschen agilen Methoden verschrieben worden ist (was immer mal passieren kann), dann sind die hervorragenden Bedingungen für das Gelingen einer agilen Transformation geschaffen.
Zu dieser Ehrlichkeit gehört unbedingt auch, dass sich Beraterinnen und Berater nicht auf faulen Ausreden berufen, wenn die agile Transformation trotzdem scheitert. Denn das ist ebenso verlockend, wie die Wundermittel-Falle.
Ausrede 1: Der Widerstand und die Herausforderung war einfach zu groß!
Die beliebteste agile Ausrede schiebt das Scheitern rund um Agilität einfach auf die Beharrungskräfte im Unternehmen. Die Strukturen und Prozesse sind eben viel zu tief verankert, als dass die Transformation gelingen könnte, so wird dann achselzuckend analysiert. Weil zu viele Interessen gefährdet sind, stemmen sich an allen Ecken und Ende die Strukturen ebenso wie die beteiligten Menschen gegen die Veränderung an. Keine Chance.
Die ehrliche Antwort:
Natürlich gibt es diese Beharrungskräfte und das Festhalten am Vertrauten ist immer ein wesentlicher Bremsklotz für agile Transformationen. Dieser Tatsache lässt sich aber mit eigenem Beharrungsvermögen gut begegnen: Veränderungsbegleitung heißt immer auch an den Herausforderungen dranbleiben, aus Rückschlägen lernen und den Beteiligten beim schmerzlichen Loslassen des Alten helfen. Unsere Beobachtung nach braucht es sieben Sprint im Scrum, bis ein Team das neue Konzept und die Rollen adaptiert die kontinuierliche Verbesserung greift und mit Hilfe der agilen Methoden in der Zusammenarbeit effektiv wird.
Ausrede 2: Es fehlt einfach an der richtigen Einstellung, um Agilität voranzutreiben!
Eng verknüpft mit dem Beharrungsvermögen in Unternehmen ist die Ausrede, dass das Mindset nicht stimmt – wahlweise, dass der Reifegrad im Team oder Unternehmen nicht hoch genug ist. Doch auch das ist oft zu kurz gedacht. Denn oft wird durch die Transformation selbst die Anti-Haltung verhärtet, nämlich dann, wenn sie schlecht begleitet wird. Dann entsteht schnell der Eindruck: Was bisher war, ist nicht gut genug. Für einige folgt daraus dann die bittere Erkenntnis und Denkweise: Ich bin nicht (mehr) gut genug.
Das Ergebnis ist ein Veränderungsparadoxon, wie es Fritz B. Simon ausformuliert hat: Der Innovationsdruck motiviert die Erneuerer in der Organisation zum Innovieren. Das führt zwangsläufig auch zum Verlernen und Zerstören des Alten, was wiederum die Bewahrer in den Organisationen demotiviert und sie veranlasst, das Veränderungsvorhaben zu blockieren, zu verwässern oder zu ignorieren – also sich wegzuducken. Manchmal verändern sie auch die Veränderung so schnell weiter, bis sie wieder dem Alten gleicht, nur unter anderem Namen. Die Innovation scheitert dann erfolgreich und das Ganze geht wieder von vorne los, weil der Innovationsdruck am Markt zunimmt (siehe Kasten).
Beispiel:
In einem internationalen Flughafen, der in der Struktur und Organisation sehr an eine Behörde erinnert, soll unternehmensweit die Software MS Teams eingeführt werden. Die internen IT-Dienstleister bieten dazu kurze Online-Schulungen an, die ausschließlich die technische Seite behandeln. Was die Einführung des Programms für die Kommunikation und Zusammenarbeit bedeuten wird und welche drastischen Nebenwirkungen das mit sich bringt, wird von niemandem angesprochen. Allerdings ahnen dies sowohl die Erneuerer, die hier neue Chancen wittern, als auch die Bewahrer, die sich beispielsweise davor fürchten, dass nun jederzeit ihr Arbeitsfortschritt transparent sichtbar ist im Team. Sie suchen deshalb Möglichkeiten, so wenig wie möglich im neuen Programm zu erledigen und finden für die tägliche Arbeit schlaue Umwege, mit denen sie ihre Ängste in den Griff bekommen. MS Teams aber läuft einfach nicht an in der Organisation.
Die ehrliche Antwort:
Hier wurden die beteiligten Menschen mit ihren Emotionen und Unsicherheiten zu sehr allein gelassen. Möglicherweise ist die Transformation im Hauruck-Verfahren eingeführt und nur auf technischer Ebene moderiert worden. Doch auch eine angemessene Begleitung auf menschlicher Ebene anzubieten und einzufordern, ist Aufgabe guter agiler Beratungen.
Ausrede 3: Die Chefetage stand nicht dahinter!
Eine dritte gern genommene Ausrede ist die, dass die Agilität nicht von oben vorgelebt wird und daher die Teams angesichts dieses Widerspruchs zwischen Ansage und Arbeitsalltag gar nicht mitziehen konnten. Auch das ist ein reales Problem für eine agile Transformation in Organisationen. Es so stehen zu lassen, ist jedoch eine Verfehlung auf Beraterseite.
Die ehrliche Antwort:
Auch hier gilt: Es ist Aufgabe und Verantwortung der agilen Beraterin, den Finger in die Wunde zu legen und diese Diskrepanz in der Chefetage anzusprechen. Nur wenn Agilität dort wirklich gewollt und gelebt wird, kann die Transformation in Organisationen gelingen. Das ist ein Grundlage jeder Transformation, die für alle Veränderungsprojekte gilt. Und zwar eine, von der ein Berater die Verantwortlichen in jedem Fall überzeugen muss.